Rechtliche Grundlagen
im Online-Handel
Gesetzesänderung hier, neue Regelungen da - Im E-Commerce gibt es eine Menge an gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Online-Händler:innen zu beachten haben. Um sich in diesem Dschungel der Gesetze nicht zu verlieren, bieten wir Ihnen hier eine Übersicht über wichtige rechtliche Grundlagen mit wertvollen Quellen für weiterführende Informationen.
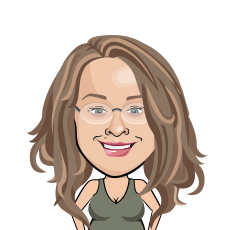

Grundlegende rechtliche Rahmenbedingungen
im E-Commerce
Neben allgemeinen Grundlagen, die sowohl für den Offline- als auch den Online-Bereich gelten, wie etwa das Unternehmensgesetzbuch (UGB) oder die Gewerbeordnung (GewO), existieren darüber hinaus sämtliche weitere Bestimmungen, welche explizit für E-Commerce relevant sind:
E-Commerce-Gesetz
Eine der wichtigen rechtlichen Rahmenbedingungen für den Online-Handel bildet das E-Commerce-Gesetz (ECG), welches 2002 zur Umsetzung der E-Commerce-Richtlinie 2000/31/EG beschlossen wurde.
Darin sind sämtliche Rahmenbedingungen für den elektronischen Geschäftsverkehr festgelegt, wie zum Beispiel Informationspflichten für Webshops, Regelungen, die den Vertragsabschluss betreffen und Bestimmungen zum Herkunftslandprinzip.
Verbraucherrechte-Richtlinie
2011 hat das Europäische Parlament die Verbraucherrechte-Richtlinie (VRRL) erlassen. Diese verfolgt das Ziel, die Informationspflichten an Verbraucher:innen im Fernabsatz zu harmonisieren und die nationalen rechtlichen Regelungen zum Verbraucherschutz in der EU anzugleichen. Somit werden geschäftliche Beziehungen zwischen Unternehmen und Verbraucher:innen vereinfacht.
In Österreich umgesetzt wurde die VR-Richtlinie 2014 durch das Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG) und das Verbraucherrechte-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (VRUG). Darin sind unter anderem neue Informationspflichten und Widerrufsfristen geregelt sowie Bestimmungen über das Transportrisiko und Kundenhotlines.
Richtlinie allgemeine Produktsicherheit
Die EU-Verordnung 2023/988, im Englischen als General Product Safety Regulation (GPSR) bekannt, gilt ab 13.12.2024 unmittelbar in allen Mitgliedsstaaten. Betroffen sind Hersteller, Einführer, Händler, Fulfillment-Dienstleister und Anbieter von Online-Marktplätzen. Die weitreichenden Informationspflichten gelten für Verbraucherprodukte bzw. alle Produkte, die Verbraucher:innen kaufen und anwenden können. Drum sind in vielen Fällen auch B2B-Unternehmen betroffen. Ausnahmen gelten zB für Lebens- und Futtermittel oder Medizinprodukte. Für diese Produktgruppen existieren aber schon jetzt weitreichende Informationspflichten. In Webshops müssen u.a. zwingend angeführt werden:
- Kennzeichnung des Herstellers mit Name, Handelsname oder Handelsmarke, Postanschrift und E-Mail-Adresse oder Internetadresse mit direkt angeführten Kontaktdaten.
- Für Hersteller außerhalb der EU: Kennzeichnung der verantwortlichen Person in der EU mit Name, Firma, Postanschrift und E-Mail-Adresse oder Internetadresse mit direkt angeführten Kontaktdaten.
- Identifikationskennzeichnung: Zwingende Produktabbildung und weitere Informationen wie Artikel-, Typen- oder Chargennummer.
- Eindeutige und gut sichtbare Warn- und Sicherheitshinweise in allen EU-Sprachen im Liefergebiet.
Es drohen Abmahnungen nach UWG und Strafen.
Datenschutz
Weiters gilt auch die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): Diese regelt die Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten. Dazu gehören zum Beispiel Kontaktformulare, Kundendaten oder das Ausstellen von Rechnungen, weshalb die DSGVO im E-Commerce-Bereich besonders relevant ist.
Die Verordnung wurde 2018 erlassen und ersetzt die bisher gültige EU-Datenschutzrichtlinie, wodurch das Ziel eines unionsweit einheitlichen Datenschutzniveaus, also eine Vollharmonisierung, verfolgt wird. Länderspezifische Abweichungen gibt es jedoch nach wie vor, weshalb die DSGVO durch das Datenschutzgesetz (DSG) ergänzt wird.
Näheres zu DSGVO-konformen Websites können Sie hier nachlesen.
Cookie-Richtlinie
Mit der Datenerfassung geht im Online-Bereich auch die Verwendung von Cookies einher. Die ePrivacy Richtlinie, besser unter dem Namen Cookie-Richtlinie (2009/ 136/EG) bekannt, regelt dabei die Verarbeitung personenbezogener Daten mittels Cookies. Die Umsetzung erfolgte in Österreich 2011 durch das Telekommunikationsgesetz (TKG).
Demnach ist für alle technisch nicht notwendigen Daten eine Zustimmung der Nutzer:innen erforderlich, seit 2019 ist die aktive Einwilligung zur Ermittlung personenbezogener Daten notwendig. Durch dieses „Opt-in“-Verfahren muss auf Websites ein entsprechendes Cookie-Banner eingesetzt werden.
Mediengesetz
Auch das Mediengesetz (MedienG) ist aufgrund der Bestimmungen zu Impressums-, Offenlegungs- und Kennzeichnungspflichten für im Online- und E-Commerce-Bereich tätige Unternehmen relevant.
Barrierefreiheitsgesetz
Das österreichische Barrierefreiheitsgesetz (BaFG) setzt den European Accessibility Act (EAA) in nationales Recht um. Ab 29.6.2025 müssen B2C-Webshops barrierefrei umgesetzt sein, wenn im Unternehmen mind. 10 oder Mitarbeiter:innen beschäftigt sind und die Bilanzsumme mind. 2 Mio Euro beträgt. Mehr auf unserer Seite für Barrierefreies Webdesign.
Verbrauchergewährleistungsrecht
Grundlage bildet zum einen die Warenkauf-Richtlinie 2019/771 (WKRL) der EU, welche einheitliche Rahmenbedingungen für Warenkauf-Verträge in allen Mitgliedsstaaten zur Stärkung der Verbraucher:innenrechte schafft. Die WKRL dient als Ergänzung der Verbraucherrechte-Richtlinie und der Digitale-Inhalte-Richtlinie 2019/770 (DIRL).
Das Verbrauchergewährleistungsgesetz (VGG) ist die nationale Umsetzung dieser beiden EU-Richtlinien. Sie gilt für Verbraucherverträge (B2C) über den Kauf beweglicher Sachen und über die Bereitstellung digitaler Leistungen, die seit 1.1.2022 abgeschlossen wurden. Demnach ergeben sich unter anderem für Unternehmer:innen zusammengefasst folgende Haftpflichten:
- Die Leistung weist keine Mängel und sowohl die vertraglich vereinbarten (subjektiven) als auch die gewöhnlich vorausgesetzten (objektiven) Eigenschaften auf
- Der Aktualisierungspflicht (Update) ist nachzukommen
- Installation bzw. Montage muss sachgemäß durchgeführt werden
Zu beachten sind die Verlängerung der Beweislastumkehr von 6 auf 12 Monate sowie die Informations- und Zustimmungspflicht der Verbraucher:innen bei Abweichung der objektiven Eigenschaften der Ware. Auch die Aktualisierungspflicht und die neue Verjährungsfrist von 3 Monaten, in denen nach Ablauf der bisherigen 2-jährigen Gewährleistung noch gerichtlich Klage eingebracht werden kann, gehören zu den wichtigsten Änderungen des VGG.
Omnibus-Richtlinie
Die Omnibus-Richtlinieverfolgt seit 2022 das Ziel, EU-Verbraucherschutzvorschriften zu modernisieren und besser durchzusetzen. Als Teil des sogenannten „New Deals“ für Konsument:innen werden vier EU-Richtlinien an die Anforderungen der digitalen Welt angepasst:
- Verbraucherrechte-Richtlinie
- Richtlinie über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der Preise der ihnen angebotenen Erzeugnissen
- Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken
- Richtlinie über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen
Dabei wird der Anwendungsbereich der VRRL auf Verträge über „kostenlose“ digitale Inhalte, welche durch die Angabe von personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt werden. Somit erhalten Konsument:innen auch darauf ein 14-tägiges Rücktrittsrecht sowie Recht auf vorvertragliche Informationen.
Bei Online-Marktplätzen soll durch die Omnibus-Richtlinie mehr Transparenz erreicht werden. Dazu gehört unter anderem die klare und verständliche Information der Verbraucher:innen vor Vertragsabschluss über die wichtigsten Rankingkriterien, die Sicherstellung, dass veröffentlichte Bewertungen und Rezensionen von echten Käufer:innen oder Produkttester:innen stammen und die Kennzeichnung, ob es sich um einen privaten oder gewerblichen Verkauf handelt. Auch bezahlte Positionen in Suchergebnissen müssen gekennzeichnet werden.
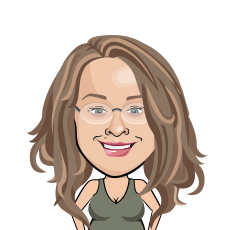

Rechtsfragen bei LIMESODA-Projekten
Als Full Service Digitalagenturversuchen wir nicht nur, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben, sondern auch neue rechtliche Rahmenbedingungen stets auf dem Radar zu haben. Im Rahmen des Projektablaufes thematisieren wir daher immer wieder rechtliche Fragen und weisen auf relevante Bestimmungen hin, um unseren Kund:innen bestmöglichen Service zu bieten.
Disclaimer: Trotz sorgfältiger Recherche sind wir keine Jurist:innen. Alle Angaben verstehen sich daher vorbehaltlich Unvollständigkeit und Fehlern sowie ohne Gewähr. Ihnen fehlen Informationen oder Sie haben einen Fehler entdeckt? Wir freuen uns über Ihr Feedback!